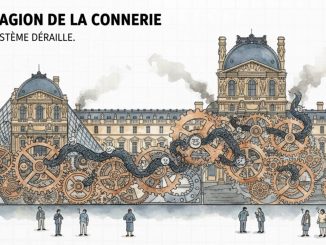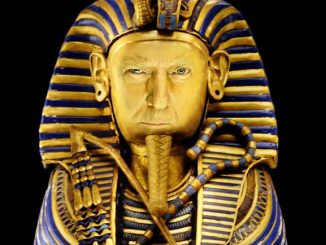Von einer jahrhundertealten Feindschaft zu einem grundlegenden Bündnis – die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist ein europäisches Epos. Dieser Artikel, der zweite in einer Reihe über die deutsch-französischen Beziehungen, zeichnet die Metamorphose zweier „Erbfeinde“ zu Säulen der Europäischen Union nach.
Alles beginnt mit der Demütigung Preußens durch Napoleon, die den Keim für einen revanchistischen deutschen Nationalismus legte. Das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts waren von unauf-hörlichen Konflikten geprägt. Der Krieg von 1870, der Erste Weltkrieg und das „Diktat“ von Versailles nährten einen Kreislauf des Hasses. Der Zweite Weltkrieg brachte diese Spirale der Zerstörung und des Antagonismus zu ihrem Höhepunkt. Doch nach 1945 wählten Visionäre wie de Gaulle und Adenauer den Weg der Versöhnung.

Die Rede an die deutsche Jugend 1962 und der Élysée-Vertrag von 1963 besiegelten diese neue Freundschaft. Konkrete Projekte wie das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), ARTE und die Deutsch-Französische Brigade stärken diese Verbindung.
Der Vertrag von Aachen aus dem Jahr 2019 festigte diese weltweit einzigartige Zusammenarbeit weiter. Diese spektakuläre Transformation, von tiefer Feindseligkeit zu einem soliden Bündnis, ist eine Lektion der Hoffnung für die internationalen Beziehungen. Es ist die Geschichte eines politischen Willens, der fähig ist, die Wunden der Vergangenheit zu überwinden – ein Beispiel für Resilienz und für den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft auf den Aschen der Teilung.
Einleitung: Das deutsch-französische Paar – Vom „Erbfeind“ zum Motor Europas
Die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich, Nationen im Herzen Europas, bildet ein historisches Geflecht von einzigartiger Komplexität und Reichhaltigkeit. Über Jahrhunderte hinweg waren ihre Schick-sale in einer oft konfliktreichen Dialektik verwoben, geprägt von verheerenden Kriegen, gegenseitigen Demütigungen und tief im kollektiven Bewusstsein verankerten Gegensätzen.
Im Laufe dieser Artikelreihe zielt unser Vorgehen darauf ab, diese turbulente Beziehung zu analysieren, ihre Entwicklung zu qualifizieren, die Beweggründe für die deutschen Haltungen zu verstehen, ohne sie zu rechtfertigen, und schließlich Lehren aus einer Geschichte zu ziehen, die, nachdem sie die Abgründe der Konfrontation erreicht hatte, den Weg zu einer vorbildlichen Versöhnung fand und das deutsch-französische Paar zu einem wesentlichen Motor des europäischen Aufbauwerks machte.
Inhaltsverzeichnis
von Joël-François Dumont — Berlin, den 26. September 2025
Der Begriff der „Erbfeindschaft“ diente lange Zeit dazu, die gegenseitige Wahrnehmung zwischen Frankreich und den deutschen politischen Gebilden, und später dem vereinten Deutschland, zu charak-terisieren.
Dieser Begriff, weit davon entfernt, ein unabänderliches Schicksal zu sein, erwies sich als eine ideologische und politische Konstruktion, genährt durch wiederholte Konflikte und die Verschärfung der Nationalismen. Die ursprüngliche Anfrage betonte zu Recht, dass einige diese Feindseligkeiten „missbräuchlich als erblich bezeichnet“ haben.
Jüngste politische Stellungnahmen, insbesondere im Umfeld des Vertrags von Aachen 2019, bestätigen, dass dieses Konzept „der Vergangenheit angehört“ und dass das Bestreben nun darin besteht, sicherzustellen, dass es „nie wieder Teil unseres Vokabulars sein wird“, ja sogar, es durch das des „Erbfreundes“ zu ersetzen. Diese radikale Transformation, von einer jahrhundertealten Feindseligkeit zu einer strukturierenden Partnerschaft, stellt eine außergewöhnliche Fallstudie in den Annalen der internationalen Beziehungen dar. Es sei aus Gründen der faktischen Genauigkeit darauf hingewiesen, dass die Schlacht von Austerlitz, die oft als früher Meilenstein dieser Feindseligkeit mit Preußen genannt wird, am 2. Dezember 1805 stattfand und nicht 1802.
Die folgende Analyse wird aufzeigen, dass die deutsch-französische Beziehung, obwohl von Zyklen von Konflikten und Demütigungen geprägt, dank eines visionären politischen Willens und eines gemeinsamen Bewusstseins für die Traumata der Vergangenheit eine tiefgreifende Metamorphose durchlaufen konnte. Dieser einzigartige Werdegang bietet wertvolle Lehren für das Verständnis der heutigen internationalen Dynamiken.
Tabelle 1: Chronologie der deutsch-französischen Konflikte und der Versöhnung
| Datum | Große Erignisse | Wichtige Akteure (Frankreich/Preussen/Deutschland) | Ergebnisse/ Auswirkungen für die deutsch-französischen Beziehungen |
|---|---|---|---|
| 1805 | Schlacht von Austerlitz | Napoleon I., Franz II. (Österreich), Alexander I. (Russland) | Französischer Sieg; indirekte Auswirkungen auf Preußen in der Folgezeit. |
| 1806 | Schlachten von Jena und Auerstedt | Napoleon I., Friedrich Wilhelm III. (Preußen) | Erdrückende Niederlage Preußens, französische Besatzung, Demütigung Preußens. |
| 1807 | Vertrag von Tilsit | Napoleon I., Friedrich Wilhelm III. (Preußen) | Teilweise Zerstückelung und strenge Auflagen für Preußen. |
| 1870-1871 | Deutsch-Französischer Krieg | Napoleon III, Otto von Bismarck | Französische Niederlage, deutsche Einigung, Annexion von Elsass-Lothringen durch Deutschland. |
| 1914-1918 | Erster Weltkrieg | France, Allemagne (Empire Allemand) | Deutschlands Niederlage, Ende der Mittelmächte. |
| 1919 | Vertrag von Versailles | Verbündete, Deutschland (Weimarer Republik) | Sehr harte Bedingun-gen für Deutschland (territorial, militärisch, finanziell, Schuld). |
| 1939-1945 | Zweiter Weltkrieg | Frankreich Deutschland (Drittes Reich) | Deutsche Niederlage, Besetzung Frankreichs, dann Befreiung, Teilung Deutschlands. |
| 1962 | Rede von Ludwigsburg | Charles de Gaulle, Konrad Adenauer | Eine wichtige symbolische Geste der Versöhnung, ein Appell an die Jugend. |
| 1963 | Elysee Vertrag | Charles de Gaulle, Konrad Adenauer | Institutionalisierte bilaterale Zusammen-arbeit, Grundlage der modernen Partnerschaft. |
| 2019 | Vertrag von Aachen | Emmanuel Macron, Angela Merkel | Vertiefung der Zusammenarbeit, Antwort auf aktuelle Herausforderungen |
1. Die Napoleonische Ära: Preußische Demütigung und das Aufkommen des deutschen Nationalgefühls
Der preußisch-französische Antagonismus, der die Beziehungen zwischen den beiden Nationen nachhaltig prägen sollte, hat tiefe Wurzeln in der napoleonischen Ära. Während Frankreich bereits Auseinander-setzungen mit Österreich hatte, nahm die Konfrontation mit Preußen ab 1806 eine besonders erbitterte Wendung und hinterließ tiefe und dauerhafte Narben.
Die Schlacht von Austerlitz (2. Dezember 1805) und ihre unmittelbaren Folgen
Der glänzende Sieg Napoleons I. bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 in der „Dreikaiserschlacht“ markierte einen wichtigen Wendepunkt im Mächtegleichgewicht Europas. Während der französische Kaiser eine gewisse Großmut gegenüber dem besiegten Österreich und Russland zeigte, war seine Haltung gegenüber Preußen, das nicht direkt an dieser Schlacht beteiligt war, aber bald die französische Macht herausfordern sollte, von ganz anderer Natur. Dieser Unterschied in der Behandlung deutete bereits auf die kommenden Spannungen hin und trug zur Bildung unterschiedlicher Wahrnehmungen in den deutschen Gebieten bei.
Die preußischen Niederlagen bei Jena und Auerstedt (14. Oktober 1806)
Preußen, das sich damals als Inhaber der besten Armee Europas betrachtete, erlitt in den Doppel-schlachten von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 eine beispiellose militärische Katastrophe. Die preußische Armee wurde von den napoleonischen Truppen buchstäblich vernichtet. Napoleon hatte auf einen dauerhaften Frieden gehofft, aber ein preußisches Ultimatum, das den Rückzug der französischen Truppen über den Rhein forderte, zwang ihn zum Handeln. Der französische Gegenschlag war vernichtend. Die preußischen Verluste waren beträchtlich, einschließlich 10.000 Tote und Verwundete, 3.000 Gefangene und 115 Kanonen allein bei Auerstedt, wo Marschall Davout entgegen den Vorhersagen Napoleons dem Großteil der preußischen Armee gegenüberstand und ihn besiegte. Diese Niederlagen waren nicht nur militärischer Natur; sie stellten einen tiefen psychologischen Schock dar, eine nationale Demütigung für einen Staat, dessen Identität und Stolz größtenteils auf seiner militärischen Tradition und Effizienz beruhten. Königin Luise von Preußen, eine emblematische und geliebte Figur, starb angeblich aus Kummer über diese Ereignisse und wurde zum Symbol für das Martyrium der Nation. Dieses anfängliche Trauma nährte ein starkes antifranzösisches Gefühl und den Wunsch nach Rache, der jahrzehntelang schwelen sollte.
Der Tilsiter Frieden (Juli 1807) und seine verheerenden Folgen für Preußen
Die preußische Demütigung wurde durch den Frieden von Tilsit besiegelt, der im Juli 1807 zwischen Napoleon, Zar Alexander I. von Russland und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen unterzeichnet wurde. Die Preußen auferlegten Bedingungen waren von extremer Härte. Das Königreich verlor fast die Hälfte seines Territoriums und seiner Bevölkerung (etwa 5 Millionen Einwohner) sowie fast alle seine Festungen. Eine erdrückende Kriegsentschädigung in Höhe von 120 bis 140 Millionen Francs wurde ihm auferlegt, und seine Armee wurde auf ein Kontingent von 42.000 Mann reduziert. Darüber hinaus wurde Preußen gezwungen, der Kontinentalsperre gegen England beizutreten. Die persönliche Behandlung, die Napoleon König Friedrich Wilhelm III. zuteilwerden ließ, die als verächtlich und distanziert beschrieben wurde, stand im Gegensatz zur Achtung, die dem russischen Zaren entgegengebracht wurde, was das Gefühl der Erniedrigung nur noch verstärkte. Die Klauseln des Vertrags, wie die Abtretung großer Gebiete zur Bildung des Königreichs Westphalen unter der Herrschaft von Jérôme Napoleon, zielten offensichtlich darauf ab, die preußische Macht zu zerschlagen und sie für die kommenden Jahre zu neutralisieren. Weit davon entfernt, einen dauerhaften Frieden zu sichern, säten diese drakonischen Bedingungen die Keime eines hartnäckigen Grolls und des Willens zur nationalen Wiederherstellung. Das gedemütigte und zerstückelte Preußen strebte fortan nur noch danach, seine Souveränität wiederzuerlangen und die Schmach zu tilgen.
Die intellektuelle und kulturelle Antwort: Das Erwachen des deutschen Nationalismus
Angesichts der französischen Besatzung und der nationalen Demütigung fand in den deutschen Gebieten, insbesondere in Preußen, eine tiefgreifende intellektuelle und kulturelle Reaktion statt. Diese Zeit war eine wahre Schmelztiegel für die Entstehung eines modernen deutschen Nationalgefühls. Führende Intel-lektuelle spielten eine entscheidende Rolle bei dieser Bewusstwerdung. Johann Gottlieb Fichte, mit seinen „Reden an die deutsche Nation“, die er im Winter 1807-1808 im besetzten Berlin hielt, ist ein Sinnbild dieser Bewegung. Ursprünglich den Idealen der Französischen Revolution zugeneigt, sah Fichte, wie viele seiner Zeitgenossen, in Napoleon den Totengräber dieser Ideale und die Verkörperung einer neuen Tyrannei.
Seine Reden waren ein leidenschaftlicher Aufruf zur moralischen, kulturellen und politischen Erneuerung des deutschen Volkes. Fichte verherrlichte die deutsche Sprache und Kultur und betrachtete sie als die Grundlagen einer gemeinsamen Identität und einer besonderen, ja sogar höheren Mission in der Geschichte der Menschheit. Er definierte die deutsche Nation nicht auf politischen und sozialen Grund-lagen, wie es in Frankreich mit der aus der Revolution hervorgegangenen Idee der Staats-bürgerschaft der Fall war, sondern nach kulturellen und ethnischen Kriterien: eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Herkunft und Vergangenheit, ein geografischer „Raum“, in dem sich diese Kultur entfaltet hatte. Diese Vision ermöglichte es, die bestehenden politischen Spaltungen zwischen den zahlreichen deutschen Staaten zu überwinden. Das Ziel war, die militärische Niederlage und die politische Demütigung in einen Katalysator für die nationale Einheit und das Bewusstsein für ein einzigartiges Schicksal zu verwandeln. Indem er das „deutsche Ich“ als eine primäre Realität postulierte, die fähig ist, Universalität hervor-zubringen, und das deutsche Volk als ein „Urvolk“ darstellte, das eine direkte Verbindung zu den ursprünglichen Quellen bewahrt hatte, lieferte Fichte eine mächtige ideologische Grundlage für den kulturellen und potenziell auch politischen Widerstand.
So bewirkte die napoleonische Herrschaft durch die Brutalität ihrer Erscheinung und die insbesondere Preußen zugefügte Demütigung einen paradoxen Effekt: Sie beschleunigte die Entstehung eines deutschen Nationalismus, der sich schließlich gegen Frankreich zu behaupten suchte. Die Niederlagen von Jena und Auerstedt waren nicht nur militärische Rückschläge; sie wurden zu schmerzhaften Erinnerungs-orten, zu Symbolen der nationalen Schande, die später zur Rechtfertigung weiterer Konflikte in einer unheilvollen Logik der Rache herangezogen wurden.
2. Von 1815 bis 1871: Das Ansteigen der Spannungen und die deutsche Einigung durch Eisen und Blut
Der Sturz Napoleons 1815 und der Wiener Kongress gestalteten die Landkarte Europas neu, beendeten jedoch weder die deutschen Nationalbestrebungen noch den preußischen Groll. Die Zeit bis 1871 war geprägt von einem allmählichen Anstieg der Spannungen, der Behauptung Preußens als dominierende Macht innerhalb des Deutschen Bundes und schließlich der Einigung Deutschlands unter seiner Führung, oft auf Kosten Frankreichs.
Der post-napoleonische Kontext und die Restauration
Nach 1815 erhielt Preußen einen Teil der verlorenen Gebiete zurück und gewann an Einfluss. Die unter Napoleon erlittene Demütigung hatte jedoch tiefe Spuren hinterlassen. Der Wunsch nach deutscher Einheit, getragen von liberalen und nationalistischen Strömungen, stieß auf die politische Zersplitterung des Deutschen Bundes und die Rivalität zwischen Preußen und Österreich. Die preußischen Versuche, die Initiative zu ergreifen, wie in der Anfrage für die Jahre 1830 und 1848 (während des „Völkerfrühlings“) erwähnt, zeugten von einem anhaltenden Ehrgeiz, aber die Bedingungen waren noch nicht reif, um Deutschland allein durch den preußischen Willen zu einigen.
Der Deutsch-Französische Krieg (1870-1871)
Die Machtübernahme von Otto von Bismarck als preußischer Kanzler im Jahr 1862 veränderte die Lage radikal. Als Anhänger einer skrupellosen „Realpolitik“ war Bismarck entschlossen, die deutsche Einheit um Preußen herum zu verwirklichen, eher durch „Eisen und Blut“ als durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse. Seine Strategie bestand darin, seine Gegner diplomatisch zu isolieren und Konflikte zu provozieren, die er als günstig für die preußischen Interessen ansah.
Die Ursachen des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-1871 sind komplex, aber die Kandidatur eines Hohenzollernprinzen für den spanischen Thron diente Bismarck als Vorwand. Durch eine geschickte Manipulation der „Emser Depesche“ verschärfte er die Spannungen und drängte das Frankreich Napoleons III., das bereits über den Machtzuwachs Preußens beunruhigt war, am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung. Damit gelang es Bismarck, Frankreich als den Angreifer erscheinen zu lassen, was dazu beitrug, die süddeutschen Staaten, die Preußen anfangs misstrauisch gegenüberstanden, für die gemeinsame Sache zu gewinnen.
Der Krieg war eine Folge von Katastrophen für Frankreich. Die Überlegenheit der preußischen Militärorganisation, die Qualität seiner Artillerie und die Strategie seiner Generäle führten zu schnellen Siegen. Die Schlacht von Sedan am 1. September 1870 war besonders entscheidend: Ein großer Teil der französischen Armee wurde eingekesselt und zur Kapitulation gezwungen, und Kaiser Napoleon III. selbst wurde gefangen genommen. Diese Niederlage markierte einen „seismischen Wandel in der europäischen Macht“. Die Proklamation des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles – einem höchst symbolischen Ort der französischen Monarchie – vollendete die Demütigung Frankreichs. Dieser Akt wurde als „demütigende Zeremonie für Frankreich“ empfunden, die das während der Napoleonischen Kriege vorherrschende Kräfteverhältnis umkehrte. Der Bismarck zugeschriebene Satz „Es gab Sedan, weil es Auerstedt gab“, der in der Anfrage zitiert wird, veranschaulicht perfekt diese Logik der historischen Rache, bei der der Sieg von 1870 als Antwort auf die Niederlage von 1806 gesehen wurde.
Der Friede von Frankfurt (10. Mai 1871)
Der am 10. Mai 1871 unterzeichnete Friede von Frankfurt formalisierte den deutschen Sieg und erlegte Frankreich sehr harte Bedingungen auf. Die schmerzlichste war die Abtretung des Elsass (mit Ausnahme von Belfort) und eines Teils von Lothringen (entsprechend dem heutigen Département Moselle) an das neue Deutsche Reich. Diese Gebiete wurden als „Reichsland Elsass-Lothringen“ errichtet und direkt von Berlin aus verwaltet. Darüber hinaus musste Frankreich eine kolossale Kriegsentschädigung von fünf Milliarden Goldfranken zahlen, und ein Teil seines Territoriums blieb bis zur vollständigen Zahlung dieser Summe besetzt.
Die Annexion von Elsass-Lothringen wurde in Frankreich als Amputation, als tiefe nationale Wunde und als offenkundige Ungerechtigkeit empfunden. Wie die Anfrage betont, „wurde Frankreich Elsass-Lothringen amputiert und wird nur noch leben, um diese Schmach zu tilgen“. Dieses Gefühl des Verlustes und dieser Wunsch nach „Revanche“ sollten die französische Politik und die deutsch-französischen Beziehungen nachhaltig prägen und „dauerhaften symbolischen Schaden“ anrichten. Die Rückgewinnung der „verlorenen Provinzen“ wurde zu einem Leitmotiv der Dritten Republik und einer der tiefen Ursachen für die Spannungen, die zum Ersten Weltkrieg führten. Die Annexion, obwohl ein strategischer und wirtschaftlicher Gewinn für Deutschland, erwies sich als eine ständige Quelle der Instabilität, die eine hartnäckige französische Feindseligkeit garantierte.
Die Zeit von 1815 bis 1871 sah also, wie Preußen Rache an Frankreich nahm, Deutschland unter seiner Führung einigte und seinerseits seinem Nachbarn eine nationale Demütigung zufügte. Der Zyklus von Beleidigungen und Vergeltungsmaßnahmen schien sich umgekehrt zu haben und bereitete den Boden für neue Konfrontationen. Obwohl Bismarcks Ziele 1870 hauptsächlich auf die deutsche Einigung ausgerichtet waren, gingen die Folgen seines Sieges, insbesondere die Annexion von Elsass-Lothringen, weit darüber hinaus und verankerten eine Feindseligkeit, die die deutsch-französischen Beziehungen für die nächsten fünfzig Jahre bestimmen sollte.
3. Der Erste Weltkrieg und der Vertrag von Versailles: Ein fortgesetzter Zyklus der Demütigungen
Der deutsche Sieg von 1871 und die Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles hatten das Mächtegleichgewicht in Europa tiefgreifend verändert, Frankreich gedemütigt und rachsüchtig zurück-gelassen und Deutschland in die Position der neuen dominierenden Macht auf dem Kontinent gebracht. Die folgenden Jahrzehnte waren von zunehmenden Spannungen, Wettrüsten und der Bildung rivalisie-render Allianzen geprägt, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führen sollten. Dieser Konflikt und der Vertrag, der ihn beendete, sollten ihrerseits Deutschland eine tiefe Demütigung zufügen und so den zerstörerischen Zyklus fortsetzen.
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) als Fortsetzung
Der im August 1914 ausgelöste Erste Weltkrieg kann, wie die Anfrage nahelegt, als Fortsetzung und Eskalation des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 analysiert werden. Die Frage von Elsass-Lothringen blieb eine offene Wunde für Frankreich und nährte einen revanchistischen Nationalismus. In Deutschland trugen der Pangermanismus und die imperialen Ambitionen zu einem Klima der Konfrontation bei. Aufeinanderfolgende internationale Krisen (insbesondere in Marokko) und die Starrheit der Bündnissysteme (Dreibund gegen Triple Entente) machten die Konfrontation nahezu unausweichlich.
Der Vertrag von Versailles (28. Juni 1919): Das deutsche „Diktat“
Nach vier Jahren eines entsetzlich mörderischen Krieges wurden Deutschland und seine Verbündeten besiegt. Der Vertrag von Versailles, unterzeichnet am 28. Juni 1919 – dem Jahrestag des Attentats von Sarajevo, das als Zünder für den Konflikt gedient hatte – wurde von den Siegermächten, hauptsächlich Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, ohne wirkliche deutsche Beteiligung an den Verhandlungen ausgearbeitet. Für Deutschland wurde dieser Vertrag sofort als „Diktat“ empfunden, als ein aufgezwungener und strafender Frieden. Die Anfrage betont, dass „alles getan wird, um Deutschland erneut zu demütigen“, und die Vertragsbedingungen schienen diese Absicht zu bestätigen, zumindest aus deutscher Sicht. Georges Clemenceau, der französische Premierminister, dessen Land am meisten unter der deutschen Invasion gelitten hatte, forderte eine „bedingungslose Unterschrift“ und versuchte, Deutschland dauerhaft zu schwächen, um die Sicherheit Frankreichs zu gewährleisten.
Die Klauseln des Vertrags waren besonders hart:
- Territoriale Klauseln: Deutschland musste Elsass-Lothringen an Frankreich zurückgeben. Es verlor auch wichtige Gebiete an Polen (insbesondere den „Danziger Korridor“, der Ostpreußen vom Rest Deutschlands trennte, und einen Teil von Oberschlesien), an Belgien (Eupen und Malmedy) und an Dänemark (Nordschleswig). Danzig wurde zu einer freien Stadt unter Verwaltung des Völkerbundes. Das kohlenreiche Saargebiet wurde für fünfzehn Jahre unter internationale Verwaltung gestellt, seine Bergwerke wurden zugunsten Frankreichs ausgebeutet. Alle deutschen Kolonien wurden beschlagnahmt und unter den Siegern aufgeteilt. Insgesamt verlor Deutschland etwa 15 % seines europäischen Territoriums und 10 % seiner Bevölkerung. „Pufferstaaten“ wie Polen und die Tschechoslowakei wurden für unabhängig erklärt.
- Militärische Klauseln: Die deutsche Armee wurde auf 100.000 Mann reduziert, ohne Wehrpflicht, ohne Luftwaffe, ohne Panzer und ohne U-Boote. Ihre Überwasserflotte wurde drastisch eingeschränkt. Das Rheinland, die Grenzregion zu Frankreich und Belgien, wurde entmilitarisiert. Deutschland musste einen großen Teil seiner vorhandenen Waffen abgeben.
- Wirtschaftliche und finanzielle Klauseln: Artikel 231 des Vertrags, die berühmte „Kriegsschuldklausel“, erklärte Deutschland und seine Verbündeten für den Ausbruch des Krieges verantwortlich. Auf dieser Grundlage wurden kolossale Kriegsreparationen gefordert (1921 auf 132 Milliarden Goldmark geschätzt). Deutschland verlor auch das Eigentum an seinen Industriepatenten (Bayers Aspirin, das in den öffentlichen Bereich überging, ist ein berühmtes Beispiel) und musste auf seine Zollabkommen verzichten und Beschränkungen für seine Importe und Exporte akzeptieren.
Die deutsche Wahrnehmung dieses Vertrags war einstimmig negativ. Der Präsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, begrüßte die aus dem Feld zurückkehrenden deutschen Soldaten mit der Erklärung, „kein Feind hat euch besiegt“, und nährte damit die „Dolchstoßlegende“, wonach die deutsche Armee nicht militärisch besiegt, sondern von Zivilisten und Revolutionären im Hinterland verraten worden sei. Diese Wahrnehmung eines ungerechten und demütigenden Friedens, der mit Gewalt aufgezwungen wurde, untergrub von Anfang an die Legitimität der jungen Weimarer Republik.
Sozioökonomische und politische Folgen in Deutschland
Die Folgen des Vertrags von Versailles für Deutschland waren tiefgreifend und langanhaltend. Die Last der Reparationen, kombiniert mit den territorialen und industriellen Verlusten, würgte die deutsche Wirtschaft ab und trug zu einer verheerenden Hyperinflation in den frühen 1920er Jahren bei. Obwohl Zahlungs-anpassungspläne (wie der Dawes-Plan 1924) eine vorübergehende Erleichterung brachten, blieb der Groll bestehen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 traf Deutschland mit voller Wucht und verschärfte Arbeits-losigkeit und soziales Elend.
Dieser Nährboden aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten, politischer Instabilität und nationaler Demütigung war äußerst fruchtbar für nationalistische und extremistische Bewegungen. Wie die Anfrage betont, führte dies im Land zu „tiefgreifenden Umwälzungen“ und vervielfachte die „Putschversuche“. Adolf Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) wusste diesen Volkszorn mit beeindruckender Effizienz auszunutzen und versprach, das „Diktat von Versailles“ zu zerreißen, die Größe Deutschlands wiederherzustellen und ihm seinen Stolz zurückzugeben. Die Unterzeichnung des Vertrags im Spiegelsaal von Versailles, dem Ort der Proklamation des Deutschen Reiches 1871, wurde als eine bewusste symbolische Demütigung empfunden, die die von 1871 umkehrte, aber dem deutschen Nationalstolz eine neue Wunde zufügte. Diese symbolische Dimension, gepaart mit der Kriegsschuldklausel, verwandelte den Vertrag in eine Quelle nationaler Schande, machte seine Akzeptanz durch die deutsche Bevölkerung nahezu unmöglich und lieferte denen, die seinen Sturz anstrebten, eine mächtige Propaganda.
So verfehlte der Vertrag von Versailles, indem er versuchte, Deutschland zu bestrafen und die Sicherheit der Alliierten, insbesondere Frankreichs, durch übermäßig harte und demütigende Maßnahmen zu gewährleisten, sein Ziel, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Im Gegenteil, er schuf die Bedingungen für sein eigenes Scheitern, indem er in Deutschland einen tiefen Wunsch nach Rache nährte und unabsichtlich den Weg für eine neue Katastrophe ebnete. Der Zyklus der Demütigungen, weit davon entfernt, durchbrochen zu werden, schien sich einfach noch einmal umgekehrt zu haben.
Tabelle 2: Vergleichstabelle der wichtigsten Verträge
| Vertrag (Jahr) | Wichtiger historischer Hintergrund | Wichtigste Klauseln für Preußen/ Deutschland | Wichtigste Klauseln/ Auswirkungen für Frankreich | Globale Auswirkungen auf die deutsch-französischen Beziehungen |
|---|---|---|---|---|
| Vertrag von Tilsit (1807) | Preußische Niederlage (Iena-Auerstedt), napoleonische Vorherrschaft. | Verlust von ~50 % des Staatsgebiets, Reduzierung der Armee auf 42.000 Mann, hohe Reparationszahlungen, Beitritt zur Kontinentalsperre. | Festigung der napoleonischen Vorherrschaft in Mitteleuropa. | Tiefe Demütigung Preußens, anti-französischer Groll, Katalysator des aufkommenden deutschen Nationalismus. |
| Frankfurter Vertrag (1871) | Französische Niederlage (Sedan), deutsche Einigung unter Preußen. | Gewinn des Elsass (ohne Belfort) und eines Teils Lothringens (Moselle), Kriegs-entschädigung in Höhe von 5 Milliarden Goldfranken. | Verlust von Elsass-Lothringen, Zahlung einer hohen Entschädigung, nationale Demütigung. | Verschärfter deutsch-französischer Antagonismus, Wunsch nach „Revanche“ in Frankreich, Festigung des Konzepts des „erblichen Feindes“. |
| Vertrag von Versailles (1919) | Deutsche Niederlage (Erster Weltkrieg). | Erhebliche Gebietsverluste (Elsass-Lothringen, Gebiete im Osten, Kolonien), Schuldklausel (Art. 231), massive Reparationen, Begrenzung der Armee auf 100.000 Mann, Entmilitarisierung des Rheinlandes. | Rückgewinnung von Elsass-Lothringen, (teilweise) Wiedergut-machung, (vorübergehende) Sicherheitsgarantie. | In Deutschland als „Diktat“ empfunden, Instabilität der Weimarer Republik, tiefer Groll, Nährboden für Extremismus und Rache. |
| Elysee Vertrag (1963) | Nach dem Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg, Wille zur Versöhnung. | Für die Bundes-Republik und Frankreich: Institutionalisierte bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Verteidigung, Bildung und Jugend. | Für Frankreich und die Bundes-Republik: Rahmen für eine neue Beziehung, die auf Vertrauen und gemeinsamen Zielen basiert. | Bruch mit dem Kreislauf der Konflikte, Gründung der modernen deutsch-französischen Partnerschaft, Motor des europäischen Aufbauwerks. |
4. Die Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg: Der Höhepunkt des Konflikts
Die Zwischenkriegszeit war eine Periode chronischer Instabilität in Europa, besonders in Deutschland, wo die Nachwirkungen des Versailler Vertrags und die Wirtschaftskrisen ein günstiges Klima für den Aufstieg des Extremismus schufen. Der von Nazideutschland ausgelöste Zweite Weltkrieg markierte den Höhepunkt der Gewalt und Zerstörung in den deutsch-französischen Beziehungen, bevor eine radikale Transformation einsetzte.
Die Krise von 1929 und der Aufstieg Hitlers
Die Weimarer Republik, bereits durch Putschversuche und Hyperinflation geschwächt, wurde von der 1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise hart getroffen. Die Wirtschaftskrise verschärfte die Arbeitslosigkeit und das soziale Elend in Deutschland erheblich und untergrub das Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Wie die Anfrage erwähnt, „verstärkte die Krise von 1929 die Situation und vervielfachte die Putschversuche bis zur Machtübernahme Hitlers“. Adolf Hitler und seine Nationalsozialistische Partei (NSDAP) wussten diese Verzweiflung auszunutzen. Ihre Propaganda, die auf der Ablehnung des „Diktats von Versailles“, dem Versprechen der Wiederherstellung der Größe Deutschlands, der Benennung von Sündenböcken (insbesondere Juden und Kommunisten) und einem übersteigerten Nationalismus basierte, fand in der Bevölkerung zunehmend Anklang. Die NSDAP, die 1928 nur 2 % der Stimmen erhielt, steigerte ihren Stimmenanteil dramatisch auf 18 % im Jahr 1930 und dann auf 38 % im Jahr 1932, womit sie zur stärksten Partei Deutschlands wurde. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Es ist wichtig anzumerken, dass der mit Versailles verbundene Groll zwar ein Faktor war, aber auch die Wirtschaftskrise und die Unterstützung einiger konservativer und industrieller Eliten, die glaubten, Hitler kontrollieren zu können, für seinen Aufstieg zur Macht entscheidend waren.
Revanchistische Rhetorik und Remilitarisierung
Einmal an der Macht, machte sich Hitler methodisch daran, die Klauseln des Versailler Vertrags, die er als unerträgliche Ungerechtigkeit und Hindernis für die Wiedergeburt der deutschen Macht betrachtete, zu demontieren. Er führte die allgemeine Wehrpflicht wieder ein, startete ein massives Aufrüstungs-programm und remilitarisierte 1936 das Rheinland unter offenkundiger Verletzung des Vertrags. Diese Maßnahmen wurden im Namen der Wiederherstellung der nationalen Ehre und des Selbstbestim-mungsrechts Deutschlands durchgeführt und fanden breite Unterstützung in der Bevölkerung. Die expansionistische Politik des Dritten Reiches manifestierte sich dann im Anschluss Österreichs im März 1938 und der Annexion des Sudetenlandes in der Tschechoslowakei im September 1938, immer unter Verletzung bestehender Verträge. Das Konzept des „Lebensraums“, das in Deutschland schon vor Hitler diskutiert wurde, wurde zu einem zentralen Dogma der Nazi-Ideologie und rechtfertigte eine Politik der Aggression und Eroberung im Osten. Der deutsche Nationalismus, der kulturelle Wurzeln und einen legitimen Wunsch nach Würde gehabt haben mag, wurde so von der Nazi-Ideologie in eine Doktrin der rassischen Überlegenheit und des brutalen Expansionismus pervertiert.
Der Zweite Weltkrieg und die Symbolik von Sedan (1940)
Der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939 löste den Zweiten Weltkrieg aus. Im Frühjahr 1940 startete die deutsche Armee ihre Offensive im Westen und setzte „Blitzkrieg“-Taktiken ein, die die Niederlande, Belgien, Luxemburg und dann Frankreich schnell überrannten. Der deutsche Durchbruch durch die Ardennen und die Überquerung der Maas bei Sedan im Mai 1940 waren von entscheidender strategischer und symbolischer Bedeutung. Dieser deutsche Sieg bei Sedan, wo die französischen Streitkräfte überrannt und in die Flucht geschlagen wurden, war eine umgekehrte und verschärfte Wiederholung der französischen Niederlage von 1870. Die Anfrage des Benutzers erwähnt, dass Hitler selbst nach Sedan reiste und dort denselben Satz wie Bismarck nach 1870 ausgesprochen haben soll („Es gab Sedan, weil es Auerstedt gab“), was die Hartnäckigkeit dieser Erinnerung an Demütigungen und den Willen, eine endgültige Rache zu markieren, unterstreicht. Dieser bewusste Akt, sich auf historische Orte und Worte zu beziehen, zeigt eine bewusste Manipulation des kollektiven Gedächtnisses für politische und psychologische Kriegszwecke, mit dem Ziel, den Sieg von 1940 als den Höhepunkt eines langen Zyklus von Racheakten und die endgültige Umkehrung vergangener Demütigungen, einschließlich der von Versailles, zu etablieren.
Besatzung und Kollaboration
Die schnelle Niederlage Frankreichs im Juni 1940 war ein nationales Trauma. Das Land wurde geteilt, mit einer von Deutschland besetzten Zone im Norden und an der Atlantikküste und einer „freien Zone“ im Süden, die vom Vichy-Regime des Marschalls Pétain regiert wurde, das eine Politik der Kollaboration mit dem nationalsozialistischen Besatzer betrieb. Diese Zeit der Besatzung, der Entbehrungen, der Unterdrückung und der Kollaboration markierte den tiefsten Punkt der französischen Souveränität und ein besonders dunkles Kapitel der deutsch-französischen Beziehungen, das von Herrschaft und Unterdrückung geprägt war.
Der Zweite Weltkrieg trieb den deutsch-französischen Antagonismus somit auf die Spitze. Die maßlosen Ambitionen und die kriminelle Ideologie des Naziregimes stürzten Europa und die Welt in eine beispiellose Katastrophe. Für Frankreich waren die Niederlage von 1940 und die Besatzung eine tiefe Demütigung, während der Krieg für Deutschland mit einer totalen Niederlage, massiven Zerstörungen, der Enthüllung des Schreckens des Holocaust und der Teilung des Landes endete. Auf diesen Trümmern und diesem Feld moralischer Verwüstung sollte, gegen jede Erwartung, ein Prozess der Versöhnung beginnen.
5. Die deutsch-französische Versöhnung: Ein visionärer politischer Wille
Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hinterließ Europa in Trümmern, Deutschland besiegt, geteilt und moralisch diskreditiert, und Frankreich, obwohl unter den Siegern, tief verwundet und geschwächt. Der Kontext des beginnenden Kalten Krieges, mit der Teilung der Welt in zwei gegnerische Blöcke, sollte jedoch eine neue Notwendigkeit schaffen: die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit in Westeuropa, um der sowjetischen Bedrohung zu begegnen. In diesem Rahmen und dank der außergewöhnlichen Vision und des Mutes einiger Staatsmänner vollzog sich eine historische Wende: die deutsch-französische Versöhnung.
Der Nachkriegskontext: Ruinen und Teilung
Insbesondere Deutschland ging ausgeblutet aus dem Konflikt hervor. Seine Städte waren zerstört, sein Territorium von den vier alliierten Mächten (USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion) besetzt und bald in zwei getrennte Staaten geteilt: die Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Westen und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) im Osten. Das Bewusstsein für die vom NS-Regime begangenen Verbrechen, insbesondere den Holocaust, legte Deutschland eine schwere moralische und historische Last auf.
Die entscheidende Rolle von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer
Im Zentrum dieser unwahrscheinlichen Versöhnung stehen zwei bedeutende Persönlichkeiten: General Charles de Gaulle, Präsident der Französischen Republik, und Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Trotz der überwältigenden Last der Geschichte, der von ihren jeweiligen Völkern erlittenen Leiden und der angehäuften Ressentiments hatten diese beiden Staatsmänner die Weitsicht und den politischen Willen, die vergangenen Gegensätze zu überwinden, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.
Die Haltung von General de Gaulle gegenüber Deutschland hatte sich erheblich gewandelt. Unmittelbar nach dem Krieg befürwortete er eine harte Politik, die darauf abzielte, Deutschland dauerhaft zu schwächen und die Sicherheit Frankreichs zu gewährleisten, und erwog sogar eine Zerstückelung oder Internationalisierung bestimmter deutscher Regionen. Angesichts der zunehmenden sowjetischen Bedrohung und der Teilung Europas änderte sich jedoch seine strategische Vision. Er verstand, dass ein freies, demokratisches und fest im westlichen Lager verankertes Westdeutschland in enger Partnerschaft mit Frankreich für die Sicherheit des Kontinents unerlässlich war.
Konrad Adenauer seinerseits, tief geprägt von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, hatte als oberste Priorität, die junge BRD im Kreis der westlichen demokratischen Nationen zu verankern. Er sah in der Versöhnung mit Frankreich den Eckpfeiler dieser Politik, unerlässlich für die Wiedereingliederung Deutschlands, seinen moralischen und politischen Wiederaufbau und den Aufbau eines friedlichen und vereinten Europas.
Die persönliche Beziehung des Vertrauens und der gegenseitigen Achtung, die sich zwischen de Gaulle und Adenauer entwickelte, war ein entscheidender Faktor. Ihr erstes Treffen in Colombey-les-Deux-Églises, dem privaten Wohnsitz des Generals, im September 1958, legte den Grundstein für diese Verständigung. Adenauer, anfangs misstrauisch gegenüber dem, was er als de Gaulles Nationalismus empfand, wurde durch die europäische Vision des französischen Präsidenten und sein Verständnis der sowjetischen Gefahr beruhigt.
Mehrere starke symbolische Gesten prägten diese Annäherung und trugen dazu bei, die Wahrnehmungen in der öffentlichen Meinung beider Länder zu verändern:
- Der offizielle Besuch Konrad Adenauers in Frankreich im Juli 1962, der in einer gemeinsamen Messe mit General de Gaulle in der Kathedrale von Reims gipfelte. Dieser Ort, an dem viele französische Könige gekrönt wurden und der im Ersten Weltkrieg von deutscher Artillerie bombardiert worden war, wurde zum Symbol der Versöhnung.
- Die triumphale Reise von General de Gaulle durch Deutschland im September 1962. Überall, wo er hinkam, wurde er bejubelt. Seine Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg, die größtenteils auf Deutsch gehalten wurde, hatte eine enorme Wirkung. Indem er die jungen Deutschen beglückwünschte, „die Kinder eines großen Volkes“ zu sein, und gleichzeitig die „großen Fehler“ und die „großen, verdammenswerten und verdammten Unglücke“ anerkannte, die dieses Volk im Laufe seiner Geschichte begangen hatte, traf er einen empfindlichen Nerv und ebnete den Weg für eine gemeinsame Zukunft.
Diese Akte der öffentlichen Diplomatie, voller Emotionen und Symbolik, waren wesentlich, um die Geister auf einen radikalen Paradigmenwechsel in den bilateralen Beziehungen vorzubereiten. Sie zeigten einen politischen Willen, der über strategische Kalküle hinausging und eine moralische und menschliche Dimension der Versöhnung berührte.

Der Élysée-Vertrag (22. Januar 1963): Der Grundstein der Zusammenarbeit
Sechs Monate nach der Rede in Ludwigsburg, am 22. Januar 1963, unterzeichneten General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer in Paris den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, besser bekannt als Élysée-Vertrag. Dieser Vertrag besiegelte nicht nur offiziell die Versöhnung; er schuf einen ehrgeizigen und detaillierten Rahmen für eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Er markierte, wie die Website des Élysée hervorhebt, die Konsolidierung der treibenden Rolle des deutsch-französischen Paares im europäischen Aufbauwerk.
[Bild einer Gedenktafel für de Gaulle und Adenauer in Berlin] Gedenktafel für De Gaulle und Adenauer vor der KAS in Berlin — Foto © Joël-François Dumont
Die Ziele des Vertrags waren vielfältig und umfassten wesentliche Bereiche:
- Regelmäßige Konsultationen: Der Vertrag sah obligatorische und häufige Treffen auf allen Regierungsebenen vor: Staats- und Regierungschefs (mindestens zweimal jährlich), Außen-, Verteidigungs-, Bildungs- und Jugendminister (mindestens alle drei bzw. zwei Monate) und Generalstabschefs.
- Außenpolitik: Beide Regierungen verpflichteten sich, sich vor jeder Entscheidung in allen wichtigen außenpolitischen Fragen zu konsultieren, um möglichst zu einer analogen Position zu gelangen.
- Verteidigung: Eine Annäherung der strategischen und taktischen Doktrinen wurde angestrebt, mit der geplanten Schaffung deutsch-französischer Institute für operative Forschung und dem Austausch von Personal.
- Bildung und Jugend: Diesem Bereich wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da er als wesentlich für die Zukunft der Zusammenarbeit anerkannt wurde. Dies umfasste Bemühungen, den Unterricht der Partnersprache in jedem Land zu verstärken, die Beschleunigung der Gleichwertigkeit von Diplomen und die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung. Vor allem sah der Vertrag die Schaffung einer Organisation zur Entwicklung des Jugendaustauschs vor, das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW).
- Wirtschaftliche Zusammenarbeit: Der Vertrag förderte die gemeinsame Untersuchung von Wegen zur Stärkung der Zusammenarbeit in wichtigen Sektoren wie Agrarpolitik, Energie, Kommunikation und industrielle Entwicklung im Rahmen des Gemeinsamen Marktes.
Die Bedeutung des Élysée-Vertrags liegt in seinem innovativen Charakter: Es handelte sich nicht um einen einfachen Nichtangriffspakt oder eine klassische Militärallianz, sondern um ein echtes Projekt der tiefen Integration der Gesellschaften und Staatsapparate. Durch die Institutionalisierung des Dialogs und der Abstimmung auf allen Ebenen zielte er darauf ab, Kooperationsreflexe, eine Kultur des gegenseitigen Verständnisses und eine gegenseitige Abhängigkeit zu schaffen, die jede Rückkehr zur Feindseligkeit nicht nur unerwünscht, sondern strukturell schwierig machen würde. Die Priorität, die der Jugend und der Bildung eingeräumt wurde, zeugte von einer langfristigen Vision, die darauf abzielte, die Versöhnung in den Herzen und Köpfen zukünftiger Generationen zu verankern.
6. Die Früchte der Zusammenarbeit: Konkrete Initiativen und eine lebendige Partnerschaft
Der Élysée-Vertrag von 1963 war keine bloße Absichtserklärung; er legte den Grundstein für eine außergewöhnlich dichte und vielgestaltige deutsch-französische Zusammenarbeit, die sich in einer Vielzahl konkreter Initiativen und der Schaffung von Institutionen niederschlug, die zu Sinnbildern dieser einzigartigen Partnerschaft geworden sind. Diese Errungenschaften haben so unterschiedliche Bereiche wie Jugend, Kultur, Verteidigung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit berührt und ein Netz enger Verbindungen zwischen den beiden Gesellschaften geknüpft.
Jugend: Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW / OFAJ)
Eine der bedeutendsten und nachhaltigsten Schöpfungen des Élysée-Vertrags ist zweifellos das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW, oder Office Franco-Allemand pour la Jeunesse – OFAJ). Seine Aufgabe war von Anfang an, die Verbindungen zwischen jungen Deutschen und Franzosen zu festigen, ihr gegenseitiges Verständnis zu stärken, interkulturelles Lernen zu fördern und ihr Interesse für die Sprache und Kultur des Partnerlandes zu wecken. Seit seiner Gründung im Jahr 1963 hat das DFJW fast 9,5 Millionen jungen Menschen die Teilnahme an über 382.000 Austauschprogrammen ermöglicht. Es unterstützt durch-schnittlich 8.000 bis 9.000 Begegnungen pro Jahr, sei es Schul- oder Hochschulaustausch, Städtepartnerschaften, Sport- oder Kulturtreffen, Praktika oder Vereinsprojekte. Mit einem Jahresbudget von rund 30 Millionen Euro im Jahr 2019, das zu gleichen Teilen von der deutschen und der französischen Regierung finanziert wird, hat das DFJW eine unersetzliche Rolle bei der Veränderung der Mentalitäten gespielt. Indem es Generationen junger Menschen ermöglichte, das Nachbarland zu entdecken, Freundschaften zu schließen und die aus der Vergangenheit geerbten Stereotypen zu überwinden, hat es maßgeblich dazu beigetragen, die Versöhnung im Leben der Bürger zu verankern. Die Betonung der Jugend ab 1963 zeugt von einer langfristigen strategischen Vision: in zukünftige Generationen zu investieren, um die Dauerhaftigkeit von Frieden und Freundschaft zu gewährleisten.
Kultur: Der Fernsehsender ARTE und andere Initiativen
Auch die kulturelle Zusammenarbeit war eine Säule der deutsch-französischen Beziehungen. Das emblematischste Beispiel ist der Fernsehsender ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne). Er wurde durch einen am 2. Oktober 1990, am Vorabend der deutschen Wiedervereinigung, unterzeichneten Staatsvertrag gegründet und nahm am 30. Mai 1992 den Sendebetrieb auf. ARTE ist ein deutsch-französischer Kulturkanal mit europäischer Ausrichtung, der hochwertige Programme (Dokumentationen, Spielfilme, Bühnenaufführungen, Magazine) in beiden Sprachen und zunehmend auch in anderen europäischen Sprachen anbietet und damit 70 % der Europäer in ihrer Muttersprache erreicht. Sein Sitz, symbolisch in Straßburg, einer Grenzstadt und einem Symbol der europäischen Versöhnung, wird durch wichtige Zentren in Paris (ARTE France) und Baden-Baden (ARTE Deutschland) ergänzt. Die Mission von ARTE ist es, das Verständnis und die Annäherung der Völker in Europa durch ein anspruchsvolles und innovatives Kulturangebot zu fördern. Über ARTE hinaus hat sich die kulturelle Zusammenarbeit durch die gemeinsame Unterbringung von deutschen und französischen Kulturinstituten im Ausland, die Schaffung gemeinsamer digitaler Plattformen für junge Menschen (wie die Europäische Kollektion von ARTE oder das Projekt ENTR) und gemeinsame Strategien zur Förderung der Partnersprache manifestiert. Diese Initiativen zielen darauf ab, einen gemeinsamen Kulturraum zu schaffen und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen zu fördern.
Verteidigung: Die Deutsch-Französische Brigade und strategische Zusammenarbeit
Der Élysée-Vertrag sah bereits eine Annäherung der Militärdoktrinen und eine Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen vor. Diese Dimension wurde 1989 mit der Gründung der Deutsch-Französischen Brigade (DFB) sichtbar konkretisiert. Diese binationale Einheit, bestehend aus Soldaten beider Länder, ist ein starkes Symbol des wiedergefundenen Vertrauens und des Willens zur gemeinsamen Verteidigung. Die DFB war an verschiedenen internationalen Missionen beteiligt, sei es unter der Ägide der NATO (z. B. in Afghanistan) oder der Europäischen Union (insbesondere in Mali und der Zentralafrikanischen Republik), und nimmt auch an nationalen Hilfsmissionen teil. Personalaustauschprogramme, gemeinsame Aus-bildungen und intensive Sprachkurse werden organisiert, um die Interoperabilität und das gegenseitige Verständnis innerhalb der Brigade zu verbessern. Der Vertrag von Aachen 2019 hat diese Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und Sicherheit weiter gestärkt und das Engagement beider Länder unterstrichen, gemeinsam gegen die heutigen Bedrohungen vorzugehen. Ziel ist es, die gemeinsame Stimme Deutschlands und Frankreichs in den Bündnissen zu stärken und gemeinsame operative militärische Fähigkeiten bereitzustellen.
Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Während der Élysée-Vertrag bereits eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinsamen Marktes förderte, hat der Vertrag von Aachen 2019 dieser Dimension neuen Schwung verliehen. Er schuf insbesondere neue Instrumente zur Erleichterung des Austauschs und zur Vertiefung der wirtschaftlichen Integration, wie den Deutsch-Französischen Expertenrat für Wirtschaft. Besondere Aufmerksamkeit wird der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gewidmet, mit der Einrichtung eines Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ), der beauftragt ist, Hindernisse im Alltag und bei gemeinsamen Projekten in den Grenzregionen zu identifizieren und zu beseitigen. Initiativen zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Wirtschaftsrechts, zur Koordinierung der Politik in den Bereichen Energiewende und Innovation sind ebenfalls im Gange. Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH/UFA), obwohl nicht direkt aus den ursprünglichen Verträgen hervorgegangen, unterstützt Hunderte von binationalen Studiengängen und die gemeinsame Forschung und trägt so zur Ausbildung einer bikul-turellen europäischen Elite bei.
Diese vielfältigen Initiativen und viele andere mehr (Städtepartnerschaften, gemeinsame Forschungs-projekte usw.) veranschaulichen die Tiefe und Vitalität der deutsch-französischen Partnerschaft. Sie zeigen, wie ein starker politischer Wille, der in Verträgen verankert ist, sich in konkrete Errungenschaften umsetzen konnte, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und ihren Gesellschaften tiefgreifend verändert haben. Diese wachsende gegenseitige Abhängigkeit, die auf vielen Ebenen geknüpft ist, hat die Idee einer Rückkehr zur Feindseligkeit nicht nur undenkbar, sondern auch strukturell sehr schwierig gemacht. Der Übergang vom Élysée-Vertrag zum Vertrag von Aachen zeigt zudem eine Anpassungsfähigkeit dieser Zusammenarbeit, die versucht, auf die neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren und gleichzeitig das grundlegende Engagement für eine gemeinsame Zukunft zu bekräftigen.
7. Die deutsche Haltung verstehen: Jenseits der Rechtfertigung
Die deutsch-französische Beziehung zu qualifizieren und Lehren daraus zu ziehen, bedeutet auch, zu versuchen, „die Haltung der Deutschen zu verstehen, ohne sie zu rechtfertigen“, wie es die Anfrage verlangt. Dieses Unterfangen ist komplex, da sich die deutsche Haltung im Laufe der Jahrhunderte erheblich verändert hat, geprägt von spezifischen historischen Erfahrungen, ideologischen Strömungen und wechselnden geopolitischen Kontexten. Es geht nicht darum, die Fehler oder Verbrechen der Vergangenheit zu entschuldigen, sondern die Faktoren zu analysieren, die die Wahrnehmungen und Handlungen der Deutschen beeinflusst haben könnten.
Das Gewicht der aufeinanderfolgenden Demütigungen
Ein roter Faden in der deutschen Geschichte, vom Anfang des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, ist das Gefühl der nationalen Demütigung. Die Zerschlagung Preußens durch Napoleon, symbolisiert durch die Niederlagen von Jena und Auerstedt und das Diktat des Tilsiter Friedens, hinterließ eine tiefe Wunde. Diese Erfahrung wurde als unerträgliche Erniedrigung für eine stolze Militärmacht empfunden. Mehr als ein Jahrhundert später wurde der Vertrag von Versailles von einer überwältigenden Mehrheit der Deutschen als eine neue Demütigung wahrgenommen, ein „Diktat“, das von rachsüchtigen Siegern aufer-legt wurde. Der Verlust von Territorien, die erdrückenden Reparationen, die militärischen Beschränkungen und vor allem die Kriegsschuldklausel wurden als eine offenkundige Ungerechtigkeit empfunden. Dieses Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, ob diese Wahrnehmungen nun vollständig begründet waren oder nicht, war ein starker psychologischer und politischer Motor. Es nährte den Wunsch nach Wiederherstellung der Macht, der nationalen Ehre und ein Misstrauen gegenüber den Nachbarmächten, insbesondere Frankreich. Diese Opfererzählungen, ob sie aus dem napoleonischen Preußen oder dem Deutschland der Weimarer Zeit stammten, waren mächtige Mobilisierungsinstrumente, die von verschiedenen politischen Kräften genutzt wurden, um ihre Agenden zu rechtfertigen.
Die Suche nach Einheit und Identität
Während eines großen Teils seiner Geschichte war „Deutschland“ ein Mosaik aus mehr oder weniger souveränen Staaten. Die Suche nach nationaler Einheit war ein zentrales Thema des 19. Jahrhunderts. Dieses Bestreben baute sich oft im Gegensatz zu äußeren Mächten auf, und Frankreich, als mächtiger Nachbar und oft in deutsche Angelegenheiten eingreifend, spielte häufig die Rolle dieses „Anderen“, gegenüber dem sich die deutsche Identität zu definieren suchte. Intellektuelle wie Fichte trugen dazu bei, eine deutsche kulturelle und sprachliche Identität zu schmieden, die die Staatsgrenzen überschritt und die Grundlagen für einen Nationalismus legte, der später politisch instrumentalisiert werden sollte. Die von Bismarck 1871 vollzogene Einigung, obwohl „durch Eisen und Blut“ und auf Kosten eines Krieges gegen Frankreich erreicht, stellte die Erfüllung dieses langen nationalen Strebens dar.
Der Revanchismus als Motor
Der Wille, „die Schmach zu tilgen“, ist ein wiederkehrendes Thema in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, auf beiden Seiten. Während Frankreich nach 1871 auf die Revanche wartete, hatte Preußen dieses Gefühl bereits nach 1806 gekannt. Bismarcks Rhetorik, die Sedan mit Auerstedt verband, und später die Hitlers, der dieselbe Art von historischen Bezügen benutzte, um seine Aggressionen zu rechtfertigen, veranschaulichen, wie die Erinnerung an vergangene Niederlagen genutzt wurde, um gegenwärtige und zukünftige Konflikte zu legitimieren. Diese Dynamik unterhielt einen Kreislauf von Gewalt und Vergeltung.
Der Einfluss totalitärer Ideologien
Es ist entscheidend zu betonen, dass die deutsche Haltung unter dem NS-Regime (1933-1945) einen radikalen Bruch und eine Perversion früherer nationalistischer Strömungen darstellt. Der Nationalsozialismus hat zwar die aus dem Versailler Vertrag entstandenen Frustrationen und den Wunsch nach nationaler Größe ausgenutzt, aber er hat eine rassistische, antisemitische, expansionistische und völkermörderische Ideologie aufgepfropft, die zu Verbrechen von beispiellosem Ausmaß führte. Zu verstehen, wie eine Nation in eine solche Barbarei abgleiten konnte, ist eine komplexe Übung, die über die einfache Analyse der deutsch-französischen Beziehungen hinausgeht, aber es ist unbestreitbar, dass der Nährboden der Demütigung und der Instabilität der Zwischenkriegszeit die Machtübernahme durch Hitler erleichtert hat.
Die Entwicklung nach 1945: Von der Schuld zur Verantwortung
Die totale Niederlage von 1945, die Enthüllung des Ausmaßes der NS-Verbrechen und die Teilung des Landes markierten einen fundamentalen Wendepunkt. In der Bundesrepublik Deutschland (Westdeutsch-land) begann ein tiefgreifender und schmerzhafter Prozess der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit (Vergangenheitsbewältigung), wenn auch schrittweise und nicht ohne Widerstände. Die Annahme der historischen Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reiches, der Wille, mit dem Militarismus und dem aggressiven Nationalismus zu brechen, und das entschlossene Bekenntnis zu Demokratie und europäischer Integration prägten die Politik der Nachkriegs-BRD. Führungspersön-lichkeiten wie Konrad Adenauer verkörperten diesen Willen zur Erlösung und zum Wiederaufbau einer neuen deutschen Identität, friedlich und europäisch. Die Versöhnung mit Frankreich wurde zu einem zentralen Pfeiler dieser neuen Ausrichtung, wobei Deutschland versuchte, sich nicht mehr in Opposition, sondern in Partnerschaft innerhalb eines vereinten Europas neu zu definieren.
Die deutsche Haltung kann also nicht als monolithischer Block verstanden werden. Sie ist das Produkt einer komplexen Geschichte, geprägt von Traumata, nationalen Bestrebungen, ideologischen Verirrungen, aber auch von der Fähigkeit zur Selbstkritik und tiefgreifenden Transformation. Frankreich, als unmittelbarer Nachbar und Großmacht, spielte ständig eine Rolle, mal als Vorbild, mal als Rivale, mal als Gegner, bevor es zu einem wesentlichen Partner bei der Neudefinition der Identität und des Platzes Deutschlands in Europa wurde.
8. Lehren aus einer geteilten Geschichte: Vom Trauma zur gemeinsamen Verantwortung
Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, mit ihren Wechseln von blutigen Konflikten und Perioden der Annäherung, bis hin zur spektakulären Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, ist reich an Lehren, die weit über den bilateralen Rahmen hinausgehen. Diese Lehren betreffen die Natur internationaler Konflikte, die Bedingungen für den Frieden und die Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen Nationen.
- Die Destruktivität des Zyklus Demütigung-Rache: Die offensichtlichste Lehre aus dieser Geschichte ist die Sinnlosigkeit und die extreme Gefahr des teuflischen Kreislaufs, in dem die einer Nation zugefügte Demütigung unweigerlich die Keime für einen Wunsch nach Rache sät, der zu neuen Konflikten führt. Von der Zerschlagung des napoleonischen Preußens, die den preußischen Revanchismus bis Sedan 1870 nährte, über die Annexion von Elsass-Lothringen, die den französischen Nationalismus bis 1914 anheizte, bis hin zum „Diktat“ von Versailles, das zum Aufstieg des Nationalsozialismus und zur Feuersbrunst von 1939-1945 beitrug, bereitete jede Demütigung die nächste vor. Diese Gewaltspirale zeigt, dass ein auf der Demütigung des Besiegten basierender Frieden ein unsicherer und illusorischer Frieden ist.
- Die entscheidende Bedeutung des politischen Willens und visionärer Führung: Die deutsch-französische Versöhnung nach 1945 war nicht das Ergebnis des Zufalls oder einer natürlichen Entwicklung der Mentalitäten. Sie war das Ergebnis mutiger politischer Entscheidungen, getragen von Führungspersönlichkeiten wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Diese Staatsmänner hatten trotz der Last des vergangenen Leids und des allgegenwärtigen Misstrauens die Vision und die Entschlossenheit, mit der Logik der Konfrontation zu brechen. Ihre Fähigkeit, historische Traumata zu überwinden und ein neues Paradigma der Zusammenarbeit vorzuschlagen, war entscheidend. Dies unterstreicht, dass Frieden und Versöhnung vor allem politische Konstrukte sind, die Mut, Beharrlichkeit und eine langfristige Vision erfordern.
- Die Rolle der Erinnerung, der gegenseitigen Anerkennung und des Dialogs: Um den Kreislauf des Hasses zu durchbrechen, ist eine Auseinandersetzung mit der Erinnerung unerlässlich, so schmerzhaft sie auch sein mag. Dies schließt die Anerkennung des zugefügten und erlittenen Leids und sogar der eigenen Fehler ein. Die Rede von General de Gaulle an die deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962, in der er sowohl die Größe des deutschen Volkes als auch die „großen Fehler“ seiner Geschichte anerkannte, ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Ein ehrlicher und respektvoller Dialog über die unterschiedlichen Interpretationen der Vergangenheit ist eine notwendige Bedingung, um eine friedliche gemeinsame Zukunft aufzubauen. Die Fähigkeit der Nationen, einseitige Opfererzählungen zu überwinden und den Weg der Vergebung und des gegenseitigen Verständnisses einzuschlagen, wie es die Dynamik zwischen de Gaulle und Adenauer veranschaulicht, ist eine grundlegende Lehre.
- Die Stärke menschlicher, kultureller und bildungspolitischer Bindungen: Versöhnung kann sich nicht auf Abkommen zwischen Regierungen beschränken; sie muss in den Zivilgesellschaften verwurzelt sein. Initiativen wie das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), das Millionen junger Menschen ermöglicht hat, sich zu treffen und kennenzulernen, der Kulturkanal ARTE, die unzähligen Städtepartnerschaften und der universitäre Austausch haben ein dichtes Netz menschlicher Beziehungen geschaffen. Diese Verbindungen tragen dazu bei, Stereotypen abzubauen, Empathie zu fördern und ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen, das das beste Gegenmittel gegen Vorurteile und Feindseligkeit darstellt. Investitionen in Jugend und Bildung sind eine langfristige Investition in den Frieden.
- Die europäische Integration als Rahmen für Frieden und gemeinsamen Wohlstand: Indem sie ihre Versöhnung und ihre Zusammenarbeit in das größere Projekt des europäischen Aufbauwerks einbetteten, fanden Deutschland und Frankreich einen Weg, ihre nationalen Gegensätze zu überwinden. Die Europäische Union hat einen institutionellen Rahmen geschaffen, um Streitigkeiten friedlich beizulegen, gemeinsame Interessen zu entwickeln und die Souveränität in bestimmten Bereichen zu bündeln. Dieser Integrationsprozess hat ehemalige Feinde in unverzichtbare Partner verwandelt und gezeigt, dass supranationale Zusammenarbeit ein starker Motor für den Frieden sein kann. Die Stabilität und der Fortschritt der Europäischen Union sind zudem untrennbar mit der Solidität des deutsch-französischen Paares verbunden; eine Schwächung dieses „Motors“ hätte erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Kontinent.
- Die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit und kontinuierlicher Anpassung: Die Errungenschaften der deutsch-französischen Versöhnung, so solide sie auch sein mögen, dürfen niemals als endgültig betrachtet werden. Wie der ehemalige deutsche Außenminister Heiko Maas betonte, darf man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Der Aufstieg von Nationalismus, Populismus und Hassreden in Europa und der Welt erfordert ein ständiges Engagement für die deutsch-französische Freundschaft und die europäischen Werte. Die Beziehung muss ständig gepflegt, an neue Herausforderungen angepasst und neu erfunden werden, wie der Vertrag von Aachen 2019 zeigt, der darauf abzielt, die Zusammenarbeit angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu vertiefen. Versöhnung ist ein aktiver und kontinuierlicher Prozess, kein Endzustand.
Die deutsch-französische Geschichte bietet somit ein starkes Zeugnis für die Fähigkeit der Völker, die tiefsten Hassgefühle und die schwersten Traumata zu überwinden, um eine Zukunft des Friedens, der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wohlstands aufzubauen. Es ist eine Lehre der Hoffnung und der Verantwortung für die heutige Welt.
9. Schlussfolgerung: Die deutsch-französische Beziehung, ein Erbe in ständiger Bewegung
Am Ende dieser Analyse der deutsch-französischen Beziehung von der napoleonischen Ära bis heute drängen sich mehrere wichtige Feststellungen auf. Über Jahrhunderte hinweg durch das Siegel der „Erbfeindschaft“ gekennzeichnet, war diese Beziehung Schauplatz einer Folge verheerender Konflikte, gegenseitiger Demütigungen und blutiger Racheakte. Von der preußischen Zerschlagung bei Jena und Auerstedt, gefolgt vom harten Tilsiter Frieden, über die französische Niederlage von Sedan 1870 und die Annexion von Elsass-Lothringen durch den Frankfurter Frieden, bis hin zum „Diktat“ von Versailles, das Deutschland 1919 auferlegt wurde, und schließlich zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit seinem Gefolge von Schrecken und der erneuten Demütigung Frankreichs 1940, schien die deutsch-französische Geschichte in einem tragischen Zyklus gefangen zu sein.
Die deutsche Haltung wurde im Laufe dieser Prüfungen von einem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit und Demütigung geprägt, einem brennenden Wunsch nach nationaler Einheit und Anerkennung, der, instrumentalisiert durch extremistische Ideologien, zu den schlimmsten Exzessen führen konnte. Das Verständnis dieser Dynamiken, ohne jemals das Unentschuldbare zu rechtfertigen, ist wesentlich, um die Komplexität dieser Vergangenheit zu erfassen.
Dennoch ist diese Geschichte auch die einer radikalen und beispielhaften Transformation. Die deutsch-französische Versöhnung, die nach 1945 eingeleitet und 1963 durch den Élysée-Vertrag dank der Vision und des Mutes von Führungspersönlichkeiten wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer besiegelt wurde, hat gezeigt, dass es möglich ist, die Zwangsläufigkeit der Gegensätze zu durchbrechen. Diese Annäherung war nicht nur ein politischer Akt; sie verkörperte sich in einer Vielzahl konkreter Initiativen in den Bereichen Jugend (DFJW), Kultur (ARTE), Verteidigung (Deutsch-Französische Brigade) und Wirtschaft, die unauflösliche Bande zwischen den beiden Gesellschaften knüpften.
Die Lehren, die aus dieser Geschichte zu ziehen sind, sind zahlreich und von brennender Aktualität. Sie unterstreichen die Toxizität von übersteigertem Nationalismus und dem Zyklus von Demütigung und Rache. Sie heben die überragende Rolle des politischen Willens, des Dialogs, der gegenseitigen Anerkennung des Leids und einer gemeinsamen Erinnerungsarbeit hervor. Sie beweisen die Stärke des menschlichen und kulturellen Austauschs beim Aufbau von Verständnis und Vertrauen. Schließlich veran-schaulichen sie, wie die Integration in ein größeres gemeinsames Projekt, in diesem Fall der europäische Aufbau, es ermöglichen kann, bilaterale Rivalitäten zu überwinden und ein gemeinsames Schicksal zu schmieden.
Heute bleibt das deutsch-französische Paar, trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten und der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt (Aufstieg des Populismus, Wirtschaftskrisen, Fragen der europäischen Souveränität), wie die ursprüngliche Anfrage betonte, der „Motor Europas“. Der Vertrag von Aachen von 2019 zeugt vom Willen, diese einzigartige Zusammenarbeit angesichts der heutigen Herausforderungen fortzusetzen und anzupassen. Die deutsch-französische Beziehung ist kein fest-stehender Besitz, sondern ein Erbe in ständiger Bewegung, eine geteilte Verantwortung, die ein ständiges Engagement erfordert, um den Frieden zu wahren und ein geeintes, demokratisches und wohlhabendes Europa zu fördern. Ihr Weg, von der tiefsten Feindseligkeit zur engsten Freundschaft, bleibt eine Quelle der Inspiration und ein Vorbild für die internationalen Beziehungen.
Joël-François Dumont
Siehe auch:
- « D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice (2) » — (2025-0926)
- « Forging Europe: How Centuries of Conflict Became a Core Alliance (2) » — (2025-0926)
- « Vom Gegner zum Partner: Das deutsche-französische Vorbild (2) » — (2025-0926)
Sources : European-Security & Revue Défense
- « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (2) » — (2025-0927)
- « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927)
- « Les ambassadeurs de la collaboration » — (2025-0614)
- « 1945-2025 : Berlin se souvient — (2025-0510)
- « Regard numérique sur le passé et vision d’avenir » — (2025-0507)
- « Les 10 camps spéciaux soviétiques en Allemagne de l’Est » — (2025-0506)
- « La libération de Ravensbrück et de Sachsenhausen » — (2025-0505)
- « Le système concentrationnaire nazi » — (2025-0117)
- « Français et Allemands : un devoir de mémoire partagé » — (2023-0906)
- « La relation franco-allemande à l’épreuve du temps (1) » — (2010-0223)
- « L’Europe des patries : le grand dessein de Charles de Gaulle (1) » Ambassadeur Pierre Maillard — (2010-0223)
- « De Gaulle – Adenauer : une communauté de destin (3) : Georg Bucksch, Senior Vice-président, Direction de la Stratégie et du Marketing du Groupe EADS — (2010-0223)
- « Coopération dans le renseignement : “De la plus grande importance (4) » : Ambassadeur Hans Georg Wieck, président du BND (1985-1990) — (2010-0223)
- « Coopération dans le renseignement : “Un domaine privilégié (5) »: GAA François Mermet (2S), ancien DGSE — (2010-0223)
- « L’Eurocorps, traduction d’une volonté politique (8) » : Chef de Bataillon Marie-Laure Barret, ORP de l’Eurocorps — (2010-0223)
- « La brigade franco-allemande en 2010 (9)» : GBR Philippe Chalmel, CDT la brigade-franco-allemande (BFA) — (2010-0223)
- « Le Centre Multimodal des Transports (10) : GBA Philippe Carpentier, CDT le Centre Multimodal des Transports — (2010-0223)
- « Échanges sur la coopération franco-allemande (11) »: Henri Conze, DGA (93-96) et Dr Martin Guddat, directeur allemand de l’Armement (94-98) — (2010-0223)
- « L’aventure européenne : de la défense à l’industrie (12) » : Amiral Alain Coldefy, Conseiller « Défense » du président d’EADS — (2010-0223)
- « Becker : un exemple de PME franco-allemande (13) » : Roland Becker, PDG de Becker Avionics International.— (2010-0223)
Andere Quellen:
[01] „Beraten ist eine Angelegenheit vieler … Handeln ist eine Angelegenheit eines Einzelnen (De Gaulle)“: Wenn man die Memoiren von General de Gaulle und Winston Churchill, den beiden letzten Giganten dieses Jahrhunderts für die Europäer, noch einmal liest und sich ihre Reden noch einmal anhört, muss man sich sagen, dass Europa große Chancen verpasst hat, die führende Weltmacht zu bleiben … — (2023-0126) —
[02] „Die Schlacht von Austerlitz“ – Website Napoléon & Empire. Wikipedia
Hintergrund
Von einer jahrhundertelangen Feindschaft zu einer grundlegenden Allianz – die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist ein europäisches Epos. Dieser Artikel zeichnet die Verwandlung zweier „erbfeindlicher Nationen“ zu Säulen der Europäischen Union nach. Alles beginnt mit der Demütigung Preußens durch Napoleon, die den Keim für einen rachsüchtigen deutschen Nationalismus legt. Das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts waren von unaufhörlichen Konflikten geprägt. Der Krieg von 1870, der Erste Weltkrieg und das „Diktat” von Versailles schürten einen Kreislauf des Hasses. Der Zweite Weltkrieg war der Höhepunkt dieser Spirale der Zerstörung und Feindseligkeit.
Nach 1945 entschieden sich Visionäre wie de Gaulle und Adenauer jedoch für die Versöhnung. Die Rede an die deutsche Jugend von 1962 und der Élysée-Vertrag von 1963 besiegelten diese neue Freundschaft. Konkrete Projekte wie das DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk), der Fernsehsender ARTE und die Deutsch-Französische Brigade stärkten diese Verbindung.
Der Vertrag von Aachen aus dem Jahr 2019 hat diese weltweit einzigartige Zusammenarbeit weiter gefestigt. Dieser spektakuläre Wandel von tiefer Feindschaft zu einer soliden Allianz ist ein Zeichen der Hoffnung für die internationalen Beziehungen. Es ist die Geschichte eines politischen Willens, der die Wunden der Vergangenheit überwinden kann, ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit und den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft auf den Trümmern der Spaltung.